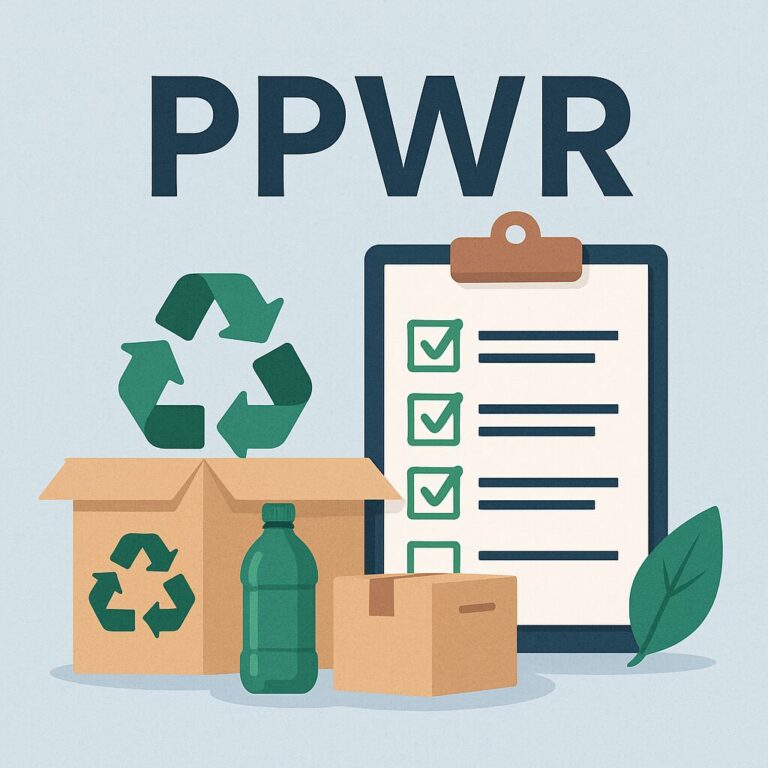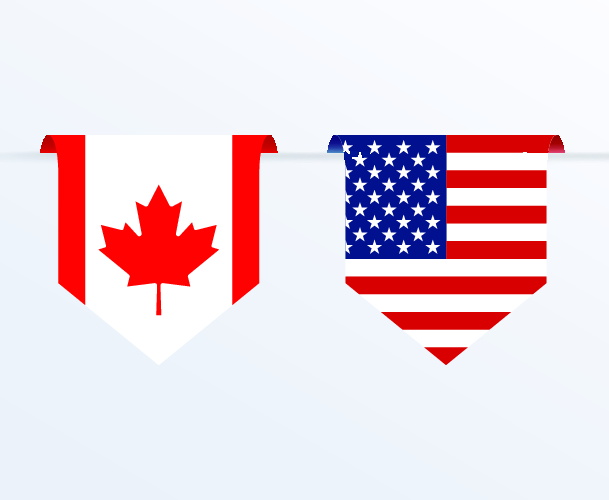Table of Contents
Einleitung: PPWR
Am 12. Februar 2025 ist die EU-Verpackungsverordnung (Packaging and Packaging Waste Regulation, PPWR) in Kraft getreten. Sie gilt ab dem 12. August 2026 für alle Unternehmen, die Verpackungen in der EU in Verkehr bringen – vom Kleinbetrieb bis zum multinationalen Konzern.
Ziel der Verordnung ist es, die Kreislaufwirtschaft zu stärken: Ab 2030 müssen alle Verpackungen recyclingfähig sein, gleichzeitig gelten konkrete Wiederverwendungsziele für bestimmte Verpackungsarten. Darüber hinaus müssen die Mitgliedstaaten ihr Verpackungsaufkommen pro Kopf reduzieren – um 5 % bis 2030, 10 % bis 2035 und 15 % bis 2040, jeweils im Vergleich zum Basisjahr 2018.
Die PPWR definiert verbindliche Anforderungen an Design, Recycling, Dokumentation und Kennzeichnung sowie konkrete Fristen, die Unternehmen jetzt kennen und umsetzen müssen.
Zentrale Neuerungen und Pflichten
Wiederverwendbarkeit (Mehrwegquoten & Refill)
Bis 2030 müssen 40 % der Transportverpackungen innerhalb der EU wiederverwendet werden; bis 2040 soll dieser Anteil auf 70 % steigen. Innerhalb eines Mitgliedstaates und zwischen Standorten desselben Unternehmens gilt bereits ab 2030 eine 100-prozentige Wiederverwendungspflicht.
Für Sammel- und Verkaufsverpackungen treten ab 2030 ebenfalls Wiederverwendungsziele in Kraft. Sie betreffen insbesondere Getränkeverpackungen und weitere definierte Verpackungsarten, wobei Ausnahmen für Produkte wie Milch und Milchprodukte, Wein oder Spirituosen bestehen.
Im HORECA-Sektor (Hotel, Restaurant und Catering) sowie im Refill-Bereich sind Letztvertreiber mit einer Verkaufsfläche von über 400 m² verpflichtet, Mehrwegalternativen anzubieten. Sie müssen außerdem die Abfüllung in von Kundinnen und Kunden mitgebrachte Behältnisse ermöglichen. Als Ziel ist ein Mehrweganteil von 10 % vorgegeben, und Händler sollen darüber hinaus anstreben, 10 % ihrer Verkaufsfläche für Refill-Stationen vorzusehen.
Ab 2030 gelten zusätzliche Verpackungsverbote. Dazu zählen Einwegkunststoff-Sammelverpackungen wie Schrumpffolie, Einwegverpackungen im HORECA-Bereich wie Becher, Teller oder Portionspackungen für Zucker, Milch und Gewürze (mit Ausnahmen für Hygiene- und Sicherheitszwecke), Einwegkunststoffverpackungen für Obst und Gemüse unter 1,5 kg sowie Einwegverpackungen im Beherbergungssektor wie kleine Shampoo-Flaschen oder Seifenstücke. Sehr leichte Plastiktüten dürfen nur noch für lose Lebensmittel oder aus hygienischen Gründen verwendet werden.
Recyclingfähigkeit (Design for Recycling)
Ab 2030 müssen alle Verpackungen recyclingfähig sein. Dafür werden sie in Recyclability Performance Grades A–C eingestuft. Die Kriterien und Methodik zur Bewertung werden bis spätestens zum 1. Januar 2028 (delegierte Rechtsakte) und zum 1. Januar 2030 (Durchführungsrechtsakte) festgelegt. Ab 2038 sind nur noch Verpackungen der Stufen A oder B erlaubt; Verpackungen der Stufe C sind dann verboten. Ausnahmen gelten befristet für innovative Verpackungen sowie für bestimmte Lebensmittelverpackungen, pharmazeutische Verpackungen und Gefahrgut.
Mindesteinsatz von Rezyklat
Ab 2030 gelten Quoten für den Einsatz von Post-Consumer-Rezyklat (PCR) in Verpackungen. Für PET-Lebensmittelverpackungen liegt der Mindestanteil bei 30 % und steigt bis 2040 auf 50 %. Für andere kontakt-sensitive Kunststoffe gilt ein Anteil von 10 bis 25 %, bis 2040 maximal 25 %. Einwegkunststoff-Getränkeflaschen müssen ab 2030 einen Anteil von 30 % Rezyklat enthalten, bis 2040 steigt dieser Wert auf 65 %. Für sonstige Kunststoffverpackungen gilt eine Quote von 35 %, die bis 2040 auf 65 % steigt.
Diese Quoten gelten für jedes Kunststoffteil, das mehr als 5 % des Gesamtgewichts einer Verpackung ausmacht. Kompostierbare Verpackungen sind von den Rezyklatquoten ausgenommen.
Verpackungsminimierung und Stoffverbote
Ab 2030 müssen Gewicht, Volumen und Schichten einer Verpackung auf das für ihre Funktionalität notwendige Maß reduziert werden. Für Transport- und E-Commerce-Verpackungen gilt ein maximal zulässiges Leerraumverhältnis von 50 %. Verpackungen mit Doppelwänden, doppelten Böden oder unnötigen Schichten werden verboten. Darüber hinaus gelten Stoffbeschränkungen, etwa für Schwermetalle (Summengrenzwerte) und PFAS in Lebensmittelkontaktmaterialien.
Kennzeichnungspflichten
Die PPWR sieht EU-weit harmonisierte Symbole und Piktogramme vor. Ab 2028 bzw. 2029 treten gestaffelt neue Pflichtangaben in Kraft. Dazu gehören Informationen über die Materialzusammensetzung, den Rezyklatanteil, die Wiederverwendbarkeit und die Zugehörigkeit zu EPR- oder Pfandsystemen. Ab 2030 müssen Informationen zu bedenklichen Stoffen digital bereitgestellt werden.
Ein Teil der Angaben muss über digitale Technologien wie QR-Codes vermittelt werden, darunter der Rezyklatanteil, die Wiederverwendbarkeit, die Abfallströme und die Herstellerangaben. Nachhaltigkeitsaussagen sind nur erlaubt, wenn die gesetzlichen Mindeststandards übertroffen werden. Ergänzend wird eine einheitliche Kennzeichnung der Abfallsammelbehälter eingeführt.
Dokumentations- und Nachweispflichten (EPR)
In jedem Mitgliedstaat wird ein Herstellerregister eingerichtet, in das sich Unternehmen eintragen müssen, sobald sie Verpackungen in Verkehr bringen. Der Zeitpunkt hängt von der nationalen Umsetzung ab, spätestens jedoch nach 2026. Die Registrierung muss in jedem Fall vor dem ersten Inverkehrbringen erfolgen.
Unternehmen sind außerdem verpflichtet, jährliche Mengenmeldungen abzugeben. Die EPR-Gebühren werden öko-moduliert gestaltet, sodass umweltfreundliche Verpackungen günstiger gestellt werden. Für Unternehmen ohne Sitz in einem Mitgliedstaat gilt eine Pflicht zur Benennung von Bevollmächtigten: EU-weit freiwillig für die Designkonformität und national verpflichtend für die Erfüllung der EPR-Vorgaben.
Pfandsysteme (Deposit Return System, DRS)
Bis zum 1. Januar 2029 müssen Mitgliedstaaten Pfandsysteme für Einweg-Getränkeflaschen aus Kunststoff und Einweg-Metallbehälter bis zu einem Fassungsvermögen von drei Litern einführen. Ziel ist eine getrennte Sammlung von mindestens 90 % dieser Verpackungen nach Gewicht. Mitgliedstaaten, die bereits im Jahr 2026 eine Quote von mehr als 80 % erreichen und bis Anfang 2028 eine Strategie zur Erreichung von 90 % vorlegen, können eine Ausnahme von dieser Verpflichtung beantragen.
Praxisleitfaden: Schritt-für-Schritt-Vorbereitung
Unternehmen sollten sich rechtzeitig auf die neuen Anforderungen vorbereiten. Der folgende Fahrplan zeigt, wie sich die Umsetzung systematisch angehen lässt:
- Interne Verpackungsanalyse durchführen: Alle eingesetzten Verpackungen müssen erfasst werden – inklusive Material, Menge, Recyclingfähigkeit (nach Grades A–C) und Rezyklatanteil. Auch das Leerraumverhältnis sollte überprüft werden.
- Lieferanten einbinden: Bereits frühzeitig sollten Lieferanten verpflichtet werden, PPWR-konforme Materialien und Nachweise bereitzustellen.
- Recyclingfähigkeit prüfen und dokumentieren: Mithilfe anerkannter Standards und Tools wie RecyClass lässt sich die Recyclingfähigkeit bewerten. Schwachstellen sollten behoben und die Ergebnisse dokumentiert werden, auch im Hinblick auf modulierte EPR-Gebühren.
- Rezyklateinsatz optimieren: Unternehmen sollten ihre Verpackungen an den neuen Quoten ausrichten, Materialtests durchführen und ein Monitoring-System für den Rezyklatanteil einrichten.
- Kennzeichnungspflichten umsetzen: Verpackungsdesigns müssen an die neuen Vorgaben angepasst werden, QR-Codes und digitale Produktinformationen integriert werden. Wichtig ist auch, Mitarbeitende und Kundinnen und Kunden rechtzeitig über die neuen Symbole und Abläufe zu informieren.
- EPR-Prozesse anpassen: Dazu gehört die Registrierung in allen relevanten Mitgliedstaaten, die Einrichtung von Systemen für Mengenmeldungen sowie die Kalkulation und Optimierung der Lizenzkosten.
- Pfandsysteme vorbereiten: Unternehmen, die unter die Pfandpflicht fallen, müssen sicherstellen, dass sie rechtzeitig an den Systemen teilnehmen und ihre Dokumentationspflichten erfüllen.
Handlungsempfehlung
Unternehmen sollten frühzeitig mit der Umsetzung beginnen. Viele Fristen wirken auf den ersten Blick weit entfernt, erfordern jedoch langwierige Anpassungen in Beschaffung, Design und Logistik.
Die Einhaltung der Vorschriften ist entscheidend, da Verstöße ab 2030 zu Vertriebsverboten führen können. Gleichzeitig bietet die Umsetzung der PPWR-Vorgaben die Chance, Nachhaltigkeit als Wettbewerbsvorteil zu nutzen, Kosten zu senken und das Markenimage zu stärken.
Schließlich empfiehlt es sich, aktiv die Zusammenarbeit mit Partnern in Mehrwegsystemen und Rücknahmelogistik zu suchen und diese mitzugestalten, um von Beginn an von Synergieeffekten und Kostenvorteilen zu profitieren.